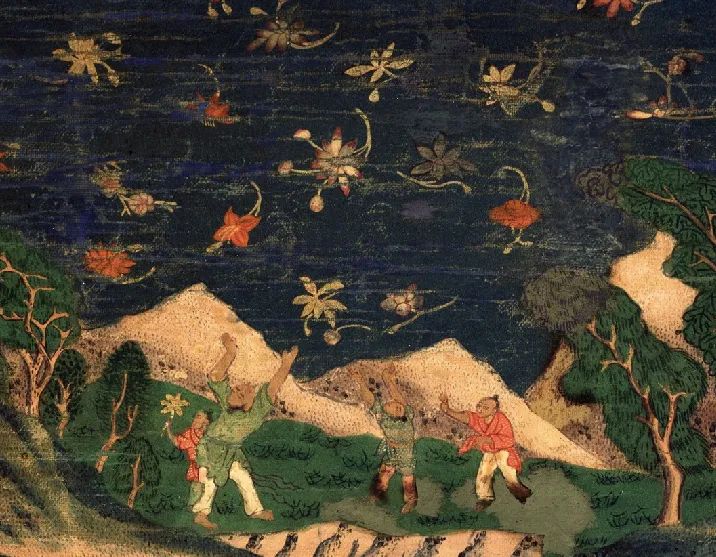
Im Handumdrehen: Wind, Regen, Schnee und Donner in Himalaya-Bildern
འདོད་པའི་ཆར་ཆེར་འབབ་པ་དང།
མེ་ཏོག་བསིལ་བྱེད་མཆོད་བྱ་དཀར།
Wenn der gewünschte Regen fällt,
Der Wind der Blumen bringt auch Schnee.
Der dritte Karmapa, Rangjung Dorje,
(1284-1339)
* „Der Wunsch nach Regen“ symbolisiert hier die bevorstehende Ankunft der Beschützer,
während „der Wind der Blumen“ sich auf die herabsteigenden himmlischen Blumen bezieht.

„Die heiligen vierundzwanzig Orte äußerster Geheimhaltung“, 18. Jahrhundert, Mead Art Museum
Dieser Satz von sieben Bildern stellt die vierundzwanzig heiligen Stätten dar, wie sie in der geheimen Übertragung des siebten Dalai Lama beschrieben werden.
Drei der Bilder stellen jeweils acht heilige Orte dar, die das Körpermandala symbolisieren.
 Das obige Bild
Das obige Bild
 Ort: Berggipfel
Ort: Berggipfel
Der Gipfel des geheimen Übungsberges ist voller Praktizierender.
Drachen versammeln sich und Donner grollt,
Zwischen den dunklen Wolken und schneebedeckten Bergen liegt die "Frucht des Windes"
(རླུང་གི་འབྲས་བུ་; auch bekannt als Regen)
Diese acht heiligen Orte sind als die „Acht kühlen Orte“ (བསིལ་ས་བརྒྱད་) bekannt.
 „Die vierundzwanzig heiligen Stätten äußerster Geheimhaltung“, 18. Jahrhundert, Mead Art Museum
„Die vierundzwanzig heiligen Stätten äußerster Geheimhaltung“, 18. Jahrhundert, Mead Art Museum
Die Hauptgottheit ist Avalokiteshvara Bodhisattva.
 Lokal
Lokal
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Wind darzustellen:
Durch die Darstellung von Drachen (Symbol für Wind und Regen)
Oder indem man Banner und Kleider im Wind flattern lässt
Der Wind um die Götter wird auch als „unbesiegbar“ bezeichnet
(མི་ཕམ་;Wächterwind)
 Tabelle: Ändernde Beziehungen und Szenenbedeutung
Tabelle: Ändernde Beziehungen und Szenenbedeutung
Wind, Regen, Donner und Schnee sind nicht nur die Naturlandschaften, die sich im Laufe der vier Jahreszeiten nicht ändern, sondern auch Zeugen von Gottheiten und Ereignissen in der buddhistischen Ikonographie. Mit Himmel und Wolken als Hauptmotiven wird in der tibetischen Textwelt ein vollständiges literarisches Dekorationssystem und eine Bildassoziation zwischen Wind, Regen, Donner und Schnee gebildet. Der Wind bewegt sich und trägt alle Elemente (འབྱུང་བའི་ཁྱིམ་; Heimat der Elemente); der Regen spendet, Reichtum und Blumen fallen vom Himmel auf die Erde; der Schnee wartet, der fallende und sich anhäufende Schnee ist Zeuge der Meditation der Gottheiten (རྣལ་འབྱོར་བའི་དགའ་རྒྱན་; bei Yogis beliebte Dekoration); der Donner erinnert die Lebewesen daran, dass Wunder und Praktizierende auf uns warten.
 „Der Gott des Windes“, alter Text aus dem Degé-Kloster
„Der Gott des Windes“, alter Text aus dem Degé-Kloster
Der Windgott (Vayu) wird verehrt und blickt nach Nordwesten
Sein Körper strahlt einen grünlich-blauen Farbton aus
Auf einem Hirsch reitend, trägt er ein Wimpel und einen Sack Winde in den Händen
Sowohl destruktiv als auch schützend
 „Roter Vajravarahi“, 15. Jahrhundert, Ruinen des Königreichs Guge
„Roter Vajravarahi“, 15. Jahrhundert, Ruinen des Königreichs Guge
Der Haarknoten der wilden Gottheit wiegt sich im Wind
Normalerweise ist es der „rote Wind“ (རླུང་དམར་)
Doch in Beschreibungen des roten zornvollen Vajrapani
Die grünen Bänder zeigen an, dass die Gottheit umgeben ist von
der grüne Wind (རླུང་ལྗང་)
Dies ist ein Symbol der Manifestation Manjushris
Und in den Händen einiger Beschützer (wie dem zornigen Shurangama)
Es gibt auch grüne Windsymbole
um das Element Wind und Windenergie darzustellen.
 Symbol eines Elements
Symbol eines Elements
Von oben nach unten sind
die Wellen repräsentieren das Element Wasser
die Flammen repräsentieren das Element Feuer
die Wirbelstürme repräsentieren das Element Wind.
 „Der ausgezeichnete Beschützer des Zorns“, 19. Jahrhundert, The Jucker Collection
„Der ausgezeichnete Beschützer des Zorns“, 19. Jahrhundert, The Jucker Collection
Erhabener Vajrabhairava(ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་)
 „Fengma-Flagge“, 20. Jahrhundert, Privatsammlung
„Fengma-Flagge“, 20. Jahrhundert, Privatsammlung
 „Der Geist des Berges Nyenchen Tanglha“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York
„Der Geist des Berges Nyenchen Tanglha“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York
Die Berggottheit erscheint oft als „Halter des Windes“ (རླུང་འཛིན་).
Die wilde Berggottheit bringt den „Pfeilwind“ (འབིགས་བྱེད་རླུང་), ein Zeichen eines bevorstehenden Krieges.
 Ort: Berggipfel
Ort: Berggipfel
Als verehrter Berggipfel
und als Gottheit der Lehren die Berggottheit.
 Lokal: Fahne flattert im Wind
Lokal: Fahne flattert im Wind
 Maitreya und Manjushri Bodhisattva, erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, Rubin Museum of Art, New York.
Maitreya und Manjushri Bodhisattva, erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, Rubin Museum of Art, New York.
Die sanfte Brise hebt den duftenden Nebel in die Luft,
Begleitet vom Duft der Opfergaben.
Der Wind (དྲི་བཞོན་;duftende Fahrt) symbolisiert
Eine der Freuden des Himmels (Heilige Schriften).
 Lokal: Duftender Nebel
Lokal: Duftender Nebel
 Lokal: Votivgabe
Lokal: Votivgabe
In der buddhistischen Erzähltradition gibt es zwei gängige Regenarten: Edelsteinregen (ནོར་ཆར་) und Blumenregen (མེ་ཏོག་ཆར་པ་). Der fünfte Dalai Lama erklärte in seinem Ritualtext über den Gelben Jambhala (Gelbe Reichtumsgottheit), dass Edelsteinregen weltlichen Reichtum und die geheime Ermächtigung des Tantra symbolisiert, während Blumenregen die Vollkommenheit der spirituellen Praxis des Praktizierenden symbolisiert. Aus kulturanalytischer Sicht findet sich die Form des Edelsteinregens in mehreren östlichen Religionen (wie etwa der Licht- und Reichtumsregen in der zoroastrischen Tradition), während Blumenregen eine rituelle Tradition auf dem südasiatischen Subkontinent ist.
 „Die Geschichte von Buddhas früheren Leben“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York City
„Die Geschichte von Buddhas früheren Leben“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York City
 Lokal: Schmuckregen
Lokal: Schmuckregen
Der Juwelenregen ist in der Originalgeschichte eine Belohnung für den tugendhaften König.
 Lokal: Haufen von Juwelen
Lokal: Haufen von Juwelen
 „Der rotnasige Elefant“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York City
„Der rotnasige Elefant“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York City
Der Rotnasen-Elefant (ཚོགས་བདག་དམར་པོ་) ist eine Schutzgottheit in der Nyingma-Tradition des tibetischen Buddhismus.
Sein Gefährte ist ein Affe.
 Lokal: Schmuckregen
Lokal: Schmuckregen
Eine andere Möglichkeit, einen Schmuckregen zu beschreiben:
Aus einem mit Juwelen gefüllten Krug strömend.
 Lokal: Rettich
Lokal: Rettich
Der Elefant mag saure und süße Speisen.
Als Opfergaben werden oft Radieschen und Süßigkeiten dargeboten.
 „Ancestor's Lineage“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art in New York
„Ancestor's Lineage“, 19. Jahrhundert, Rubin Museum of Art in New York
 Lokal: Blumenschauer
Lokal: Blumenschauer
Eines der Wunder der Natur, ein Kind sammelt die Blumen auf, die im Blumenregen fallen
Und macht daraus ihre eigene Blumenkrone
 Lokal: Blumenschauer
Lokal: Blumenschauer
 Ort: Entfernter Tempel
Ort: Entfernter Tempel
Für das schneebedeckte Plateau ist Schnee ein häufiges Symbol, das von Philosophen und Sängern verwendet wird. Im Tibetischen gibt es zwei Wörter für Schnee: „kha wa“ und „gangs“, wobei ersteres ein allgemeiner Begriff ist und letzteres sich oft auf starken Schneefall oder angehäuften Schnee bezieht. Der reine weiße Schnee ist die Quelle von Schneewasser und Nektar und kann in der Anbetung dargebracht werden (མཆོད་བྱ་). Schneebedeckte Berge sind die Wohnstätte spiritueller Praktizierender (wie der Berg Kailash); Schneelöwen sind Fabelwesen, die in schneebedeckten Bergen und Regionen leben und Macht und Würde symbolisieren.
 "Der Schneelöwe", 15. Jahrhundert, Bachmann und Eckenstein
"Der Schneelöwe", 15. Jahrhundert, Bachmann und Eckenstein
 „Porträt eines buddhistischen Mönchs“, 18. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York
„Porträt eines buddhistischen Mönchs“, 18. Jahrhundert, Rubin Museum of Art, New York
Als erster Arhat unter den sechzehn Arhats
Ajita wohnt am Berg Gandhamadana
 Lokal: Gongga-Berg
Lokal: Gongga-Berg
 „Der erste lebende Buddha Gyaltsen“ 18. Jahrhundert, New York Tambaran Gallery
„Der erste lebende Buddha Gyaltsen“ 18. Jahrhundert, New York Tambaran Gallery
Banchub Dorje, der erste Jebtsundamba Khutughtu
(1427-1489)
 Lokal: Augenmaske
Lokal: Augenmaske
Die Augenmaske (མིག་ར་) wird im tibetischen Raum vor allem zur Vorbeugung von Schneeblindheit und Blendung eingesetzt.
In der buddhistischen Praxis kann die Augenmaske jedoch auch als festes Meditationsgerät verwendet werden, um sich Schneeberge und Gottheiten in Meditationshöhlen vorzustellen.
 „Gang Rinpoche Pilgerreiseführer“, 18. Jahrhundert, Privatsammlung
„Gang Rinpoche Pilgerreiseführer“, 18. Jahrhundert, Privatsammlung
 Ort: die Quellgewässer von vier Flüssen unterhalb des Bergs Shen
Ort: die Quellgewässer von vier Flüssen unterhalb des Bergs Shen
Sie alle sind Flüsse aus Nektar, die durch die Schneeschmelze entstanden sind.
 Vor Ort: Ein Praktizierender reitet auf einem Schneelöwen
Vor Ort: Ein Praktizierender reitet auf einem Schneelöwen
 Lokal: Siegreicher freudiger Vajra
Lokal: Siegreicher freudiger Vajra
Der Gottesberg ist die Residenz von Vajrapani
Schnee wird im Vajrayana-Buddhismus oft als der Zustand der dualen Gottheiten beschrieben.
nämlich འཁྱུད་པ་ཅན་ (Hugger)
Sogar im verborgenen Reich gibt es Stürme.






